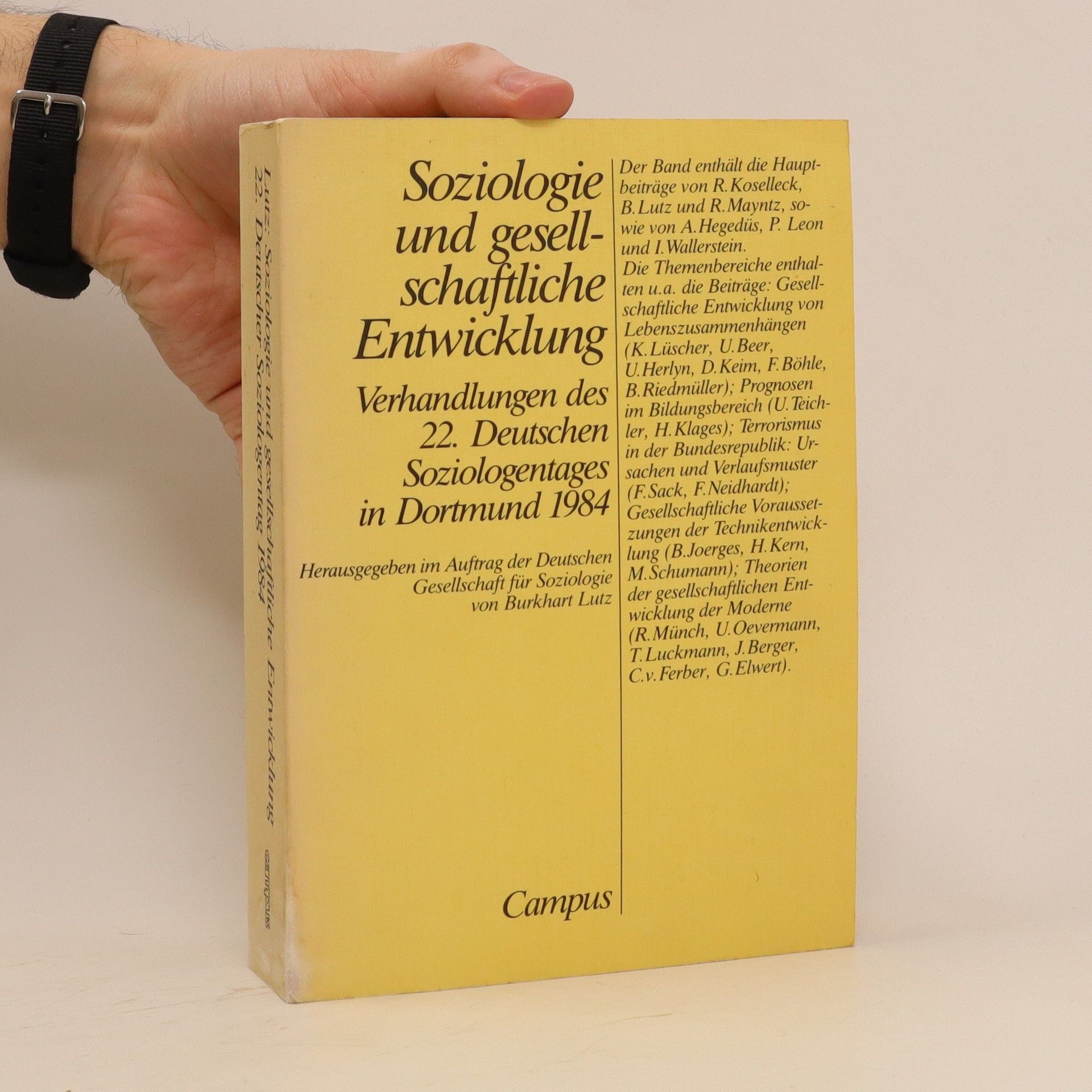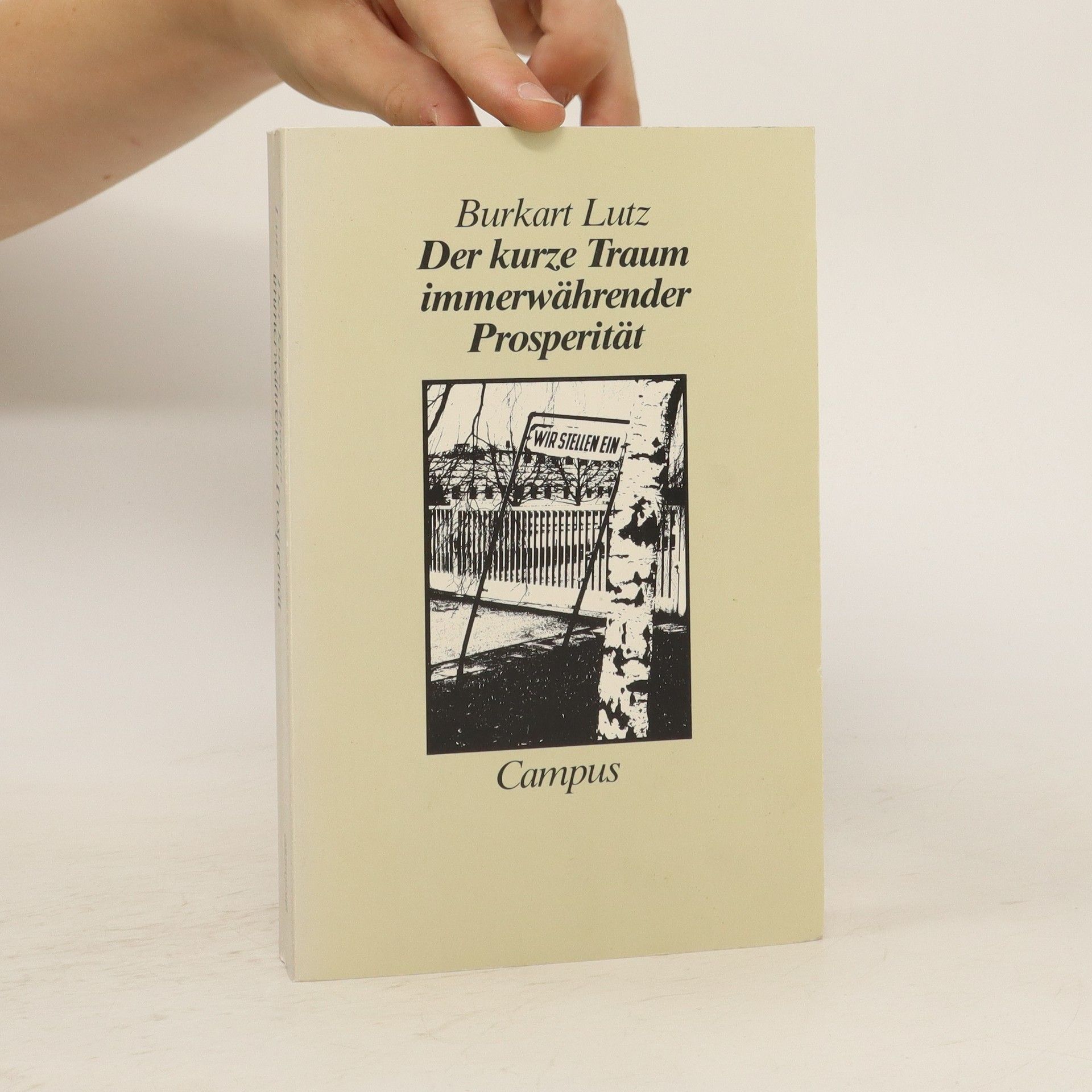Soziologie und gesellschaftliche Entwicklung
- 591 Seiten
- 21 Lesestunden
Abstract: Der Band enthält die 6 Hauptbeiträge und 48 Beiträge der 5 Themenbereiche des 22. Deutschen Soziologentages. Die Hauptbeiträge sind die Plenarvorträge der Sektionen und ein Beitrag zu zukünftigen Chancen und Problemlagen der Soziologie. Die Themenbereiche enthalten u. a. die Beiträge: gesellschaftliche Entwicklung von Lebenszusammenhängen (moderne familiale Lebensformen, städtische Lebensformen, Sozialpolitik); Prognosen im Bildungsbereich (Bildung und Wertwandel, Politikberatung durch Bildungsforschung?); Terrorismus in der Bundesrepublik - Ursachen und Verlaufsmuster; gesellschaftliche Voraussetzungen der Technikentwicklung (Steuerung der Technologieentwicklung, Industriearbeit im Umbruch, gewerkschaftliche Technologiepolitik); Theorien der gesellschaftlichen Entwicklung der Moderne (Bewußtseinsformen in der modernen Gesellschaft, Systemstabilität des Kapitalismus, Bürokratie, Hegemoniekrise). (GF)