Andeutungen
Konfigurationen im Imaginären

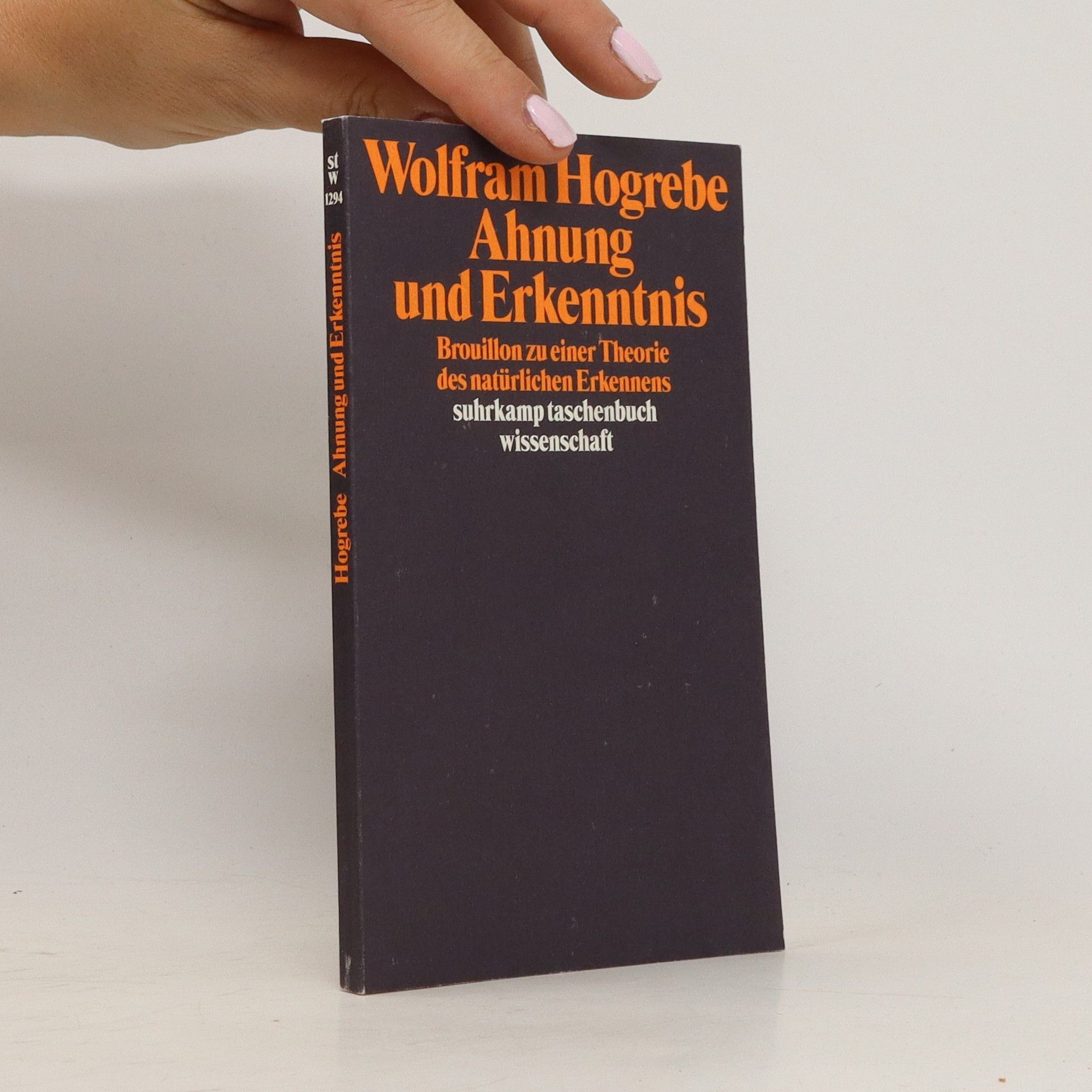




Konfigurationen im Imaginären
In "Ligaturen" setzt Wolfram Hogrebe seine informelle Erkenntnistheorie fort und analysiert essentielle Bindungen für ein menschliches Miteinander, die unterhalb theoretischer Normen liegen. Er erörtert auch die damit verbundenen Risiken und bezieht Meisterdenker sowie Randfiguren ein, um das Denken im Angesicht des subtilen Seins zu erwecken.
Wolfram Hogrebes nuanciertes Denken beschaftigt sich in diesem Buch mit dem sogenannten Zwischenreich - einem alten philosophischen Gedanken, wonach das Philosophieren es mit einer Art von Zwischenraum zu tun hat, der die Ordnungen der Begriffe und der Vorstellungen in eine bemerkenswerte Schwebe bringt. Das Zwischen ist da gleichsam ein Medium, das die Gedanken und Sprachen tragt und so in zuweilen unbekannte Gebiete fuhrt, in denen sich das Denken verandert. Hogrebe zeigt, wie sehr dieses Zwischen, das sich auch in Naturerfahrungen aufzuschliessen vermag, Thema bei so unterschiedlichen Philosophen und Dichtern wie Gottfried Wilhelm Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, Martin Heidegger, Henry David Thoreau und Peter Handke ist. Schliesslich votiert Hogrebe fur eine sensible Orientierung an einem Offenen, die selbst noch Konsequenzen fur unser politisches Leben haben konnte.
Wolfram Hogrebe engages in a mode of thinking that many contemporary philosophers dismiss as outdated: metaphysics. He argues that rethinking metaphysics is essential in our time. This book explores clarification strategies derived from exemplary philosophical questions, delving into enigmatic border zones that are difficult to navigate. It addresses themes such as absences in creative processes, the emergence of intentionality, the transition from monstrous objects to monstrous subjects, and the liberation of creativity from ambiguous semantic relationships. Additionally, it examines the significance of education in fostering conciliatory acceptance, the notion of forms as the eyes of things, and cosmology as poetics. Ultimately, the work emphasizes the importance of preserving an unavoidable mysteriousness, positioning it as the central theme of a new metaphysics. Through elegant and witty prose, Hogrebe demonstrates the robust potential of questions that lie beyond positive sciences, suggesting that if this is the essence of metaphysics, we should embrace it wholeheartedly. The book reflects a profound engagement with European philosophical thought, presented in an empathetic, compelling, and highly independent manner, marking a significant contribution to contemporary philosophical discourse.
Born in Dessau in 1940, Imi Knoebel is a leading figure of 1960s abstraction. He was a student in Joseph Beuys' master class when he began to seriously question the role of the image in painting, and by 1968 he had formulated the foundation of his practice in the seminal installation "Raum 19," which has continued to influence his work. Working in between painting and sculpture, Knoebel layers individual elements which are repeatedly juxtaposed in ever-changing variations. Over the course of his nearly five decade-long career, he has continually moved between intuition and calculation, always finding innovative ways to investigate geometric form and color. This precise retrospective volume with comprehensive texts by Dirk Martin, Johannes Stuttgen and Franz-Joachin Verspohl, among others, presents a grouping of works, made between 1966 and 2006, that were chosen by Knoebel for their fundamental importance in his practice.
Im Scherz wollte Freud sich ein Denkmal setzen und fragte, ob eines Tages eine Tafel angebracht würde, auf der stünde, dass er am 24. Juli 1895 das Geheimnis des Traumes enthüllte. Dieser Wunsch blieb ein Scherz, doch die Wirkung von „Die Traumdeutung“, veröffentlicht 1900, war enorm. Fragen zur Verbindung von Traum und Hirntätigkeit sowie zum Einfluss der physischen Verfassung regen bis heute lebhafte Diskussionen unter Empirikern und Theoretikern an. Freuds Theorie und Interpretationen eröffneten einen neuen Blick auf das Träumen, das nicht mehr als bloßer Nebenschauplatz menschlichen Lebens betrachtet wird. Das Selbstgefühl im 20. Jahrhundert zeigt sich als etwas, das über die Selbstverfügung und die Aufklärungsvernunft hinausgeht. Traumleben und Traumschreiben, sowie deren Zeichen und Darstellungen, bleiben bis heute prägend und beeinflussen neue ästhetische Formen. Freuds systematischer Zugang zur Traumdeutung bereichert weiterhin die Interpretationstheorie in verschiedenen Disziplinen, einschließlich Literaturwissenschaft, Philosophie und Theologie. Zudem ist das Erzählen von Träumen, sowohl in therapeutischen Kontexten als auch im Alltag, ein fruchtbares Feld für Kommunikationsexperten, unabhängig davon, ob es naiv oder gelehrt geschieht.
Die Deutungsnatur des Menschen
German