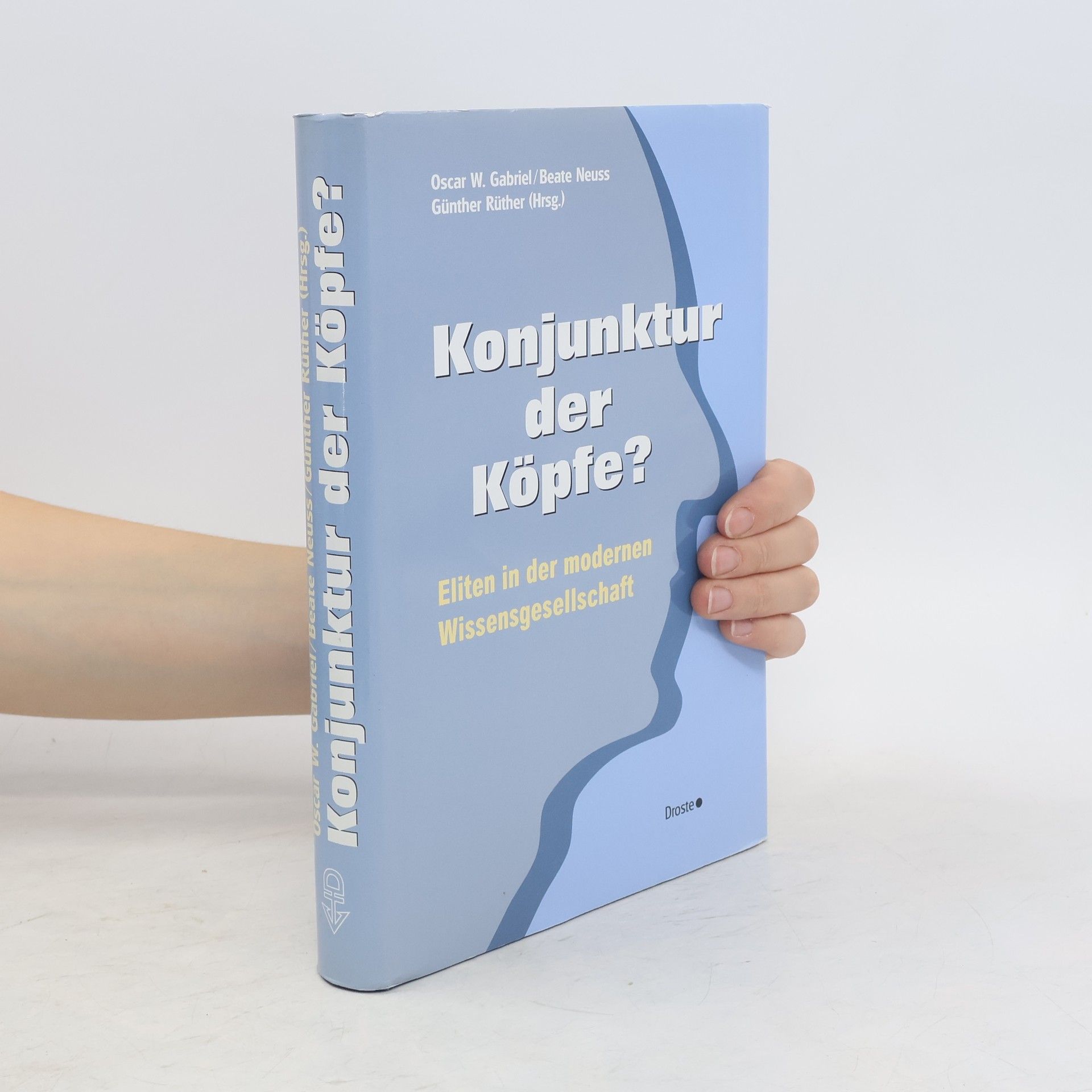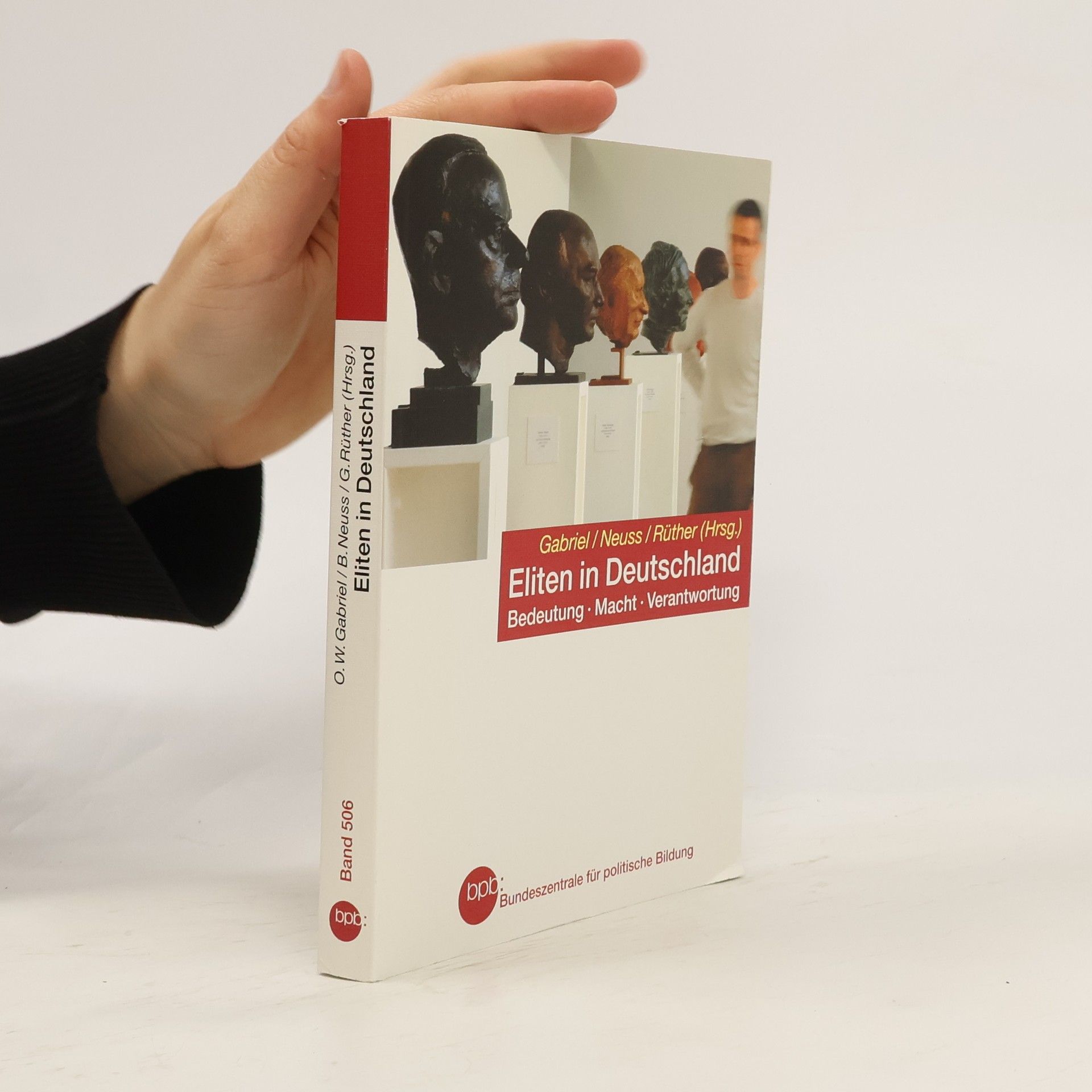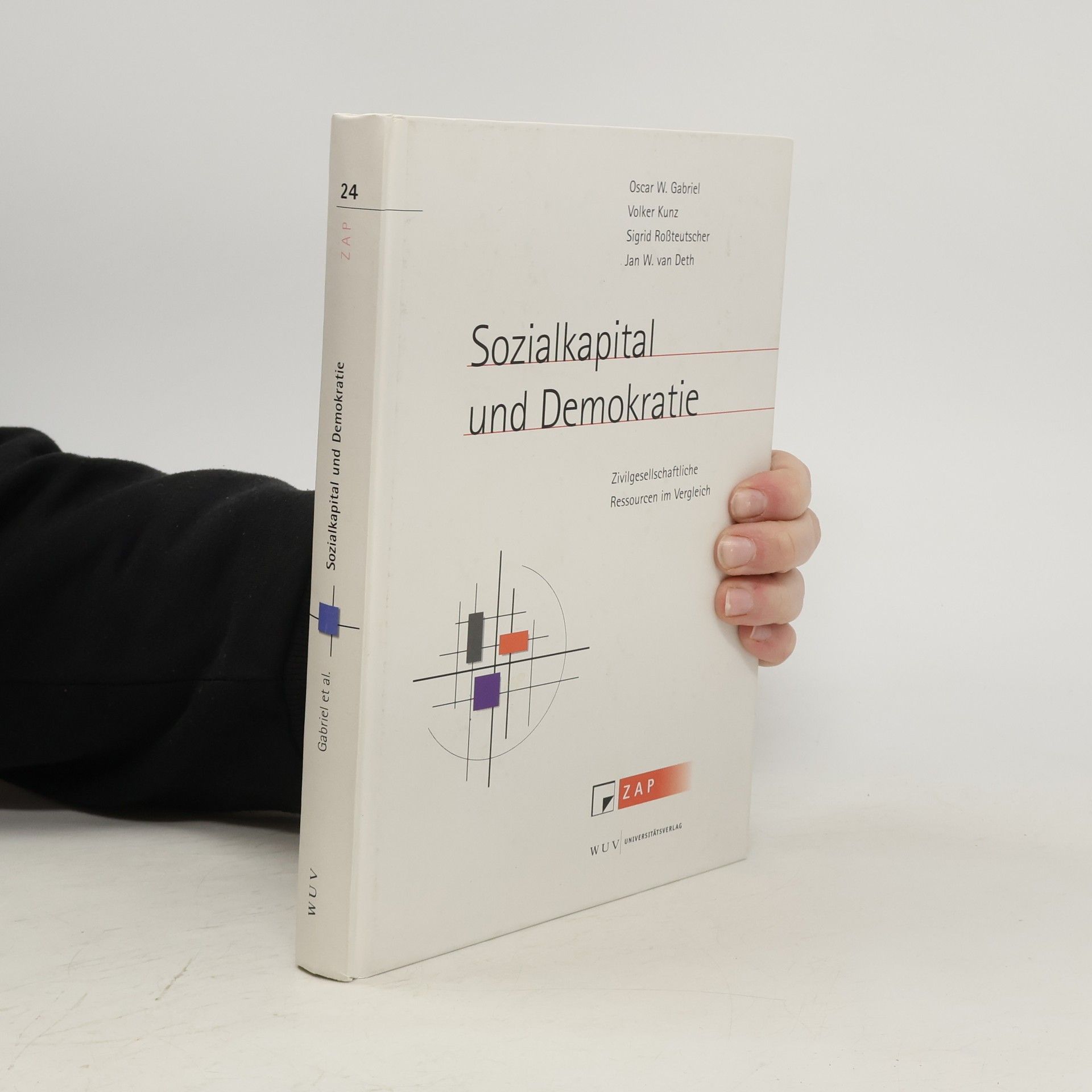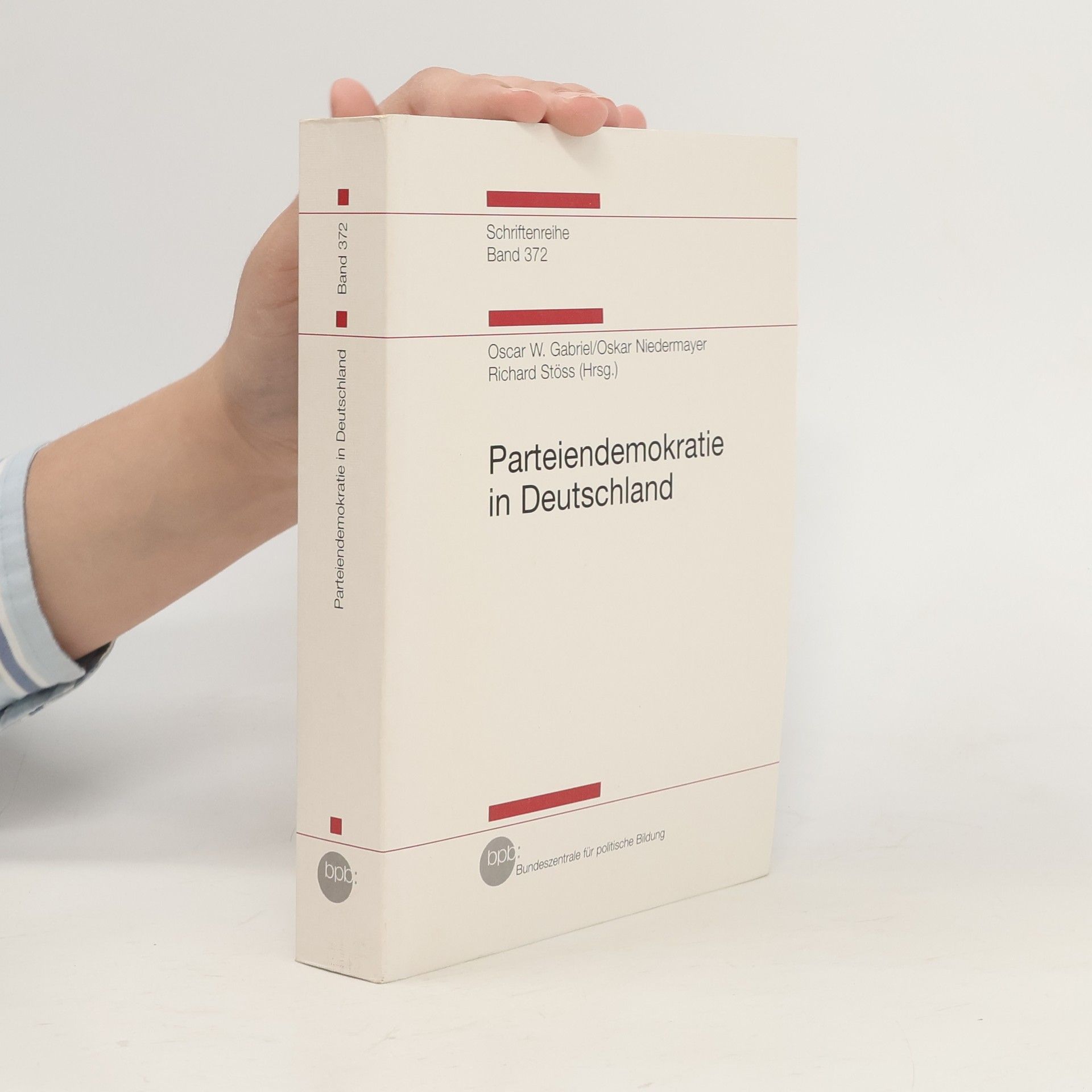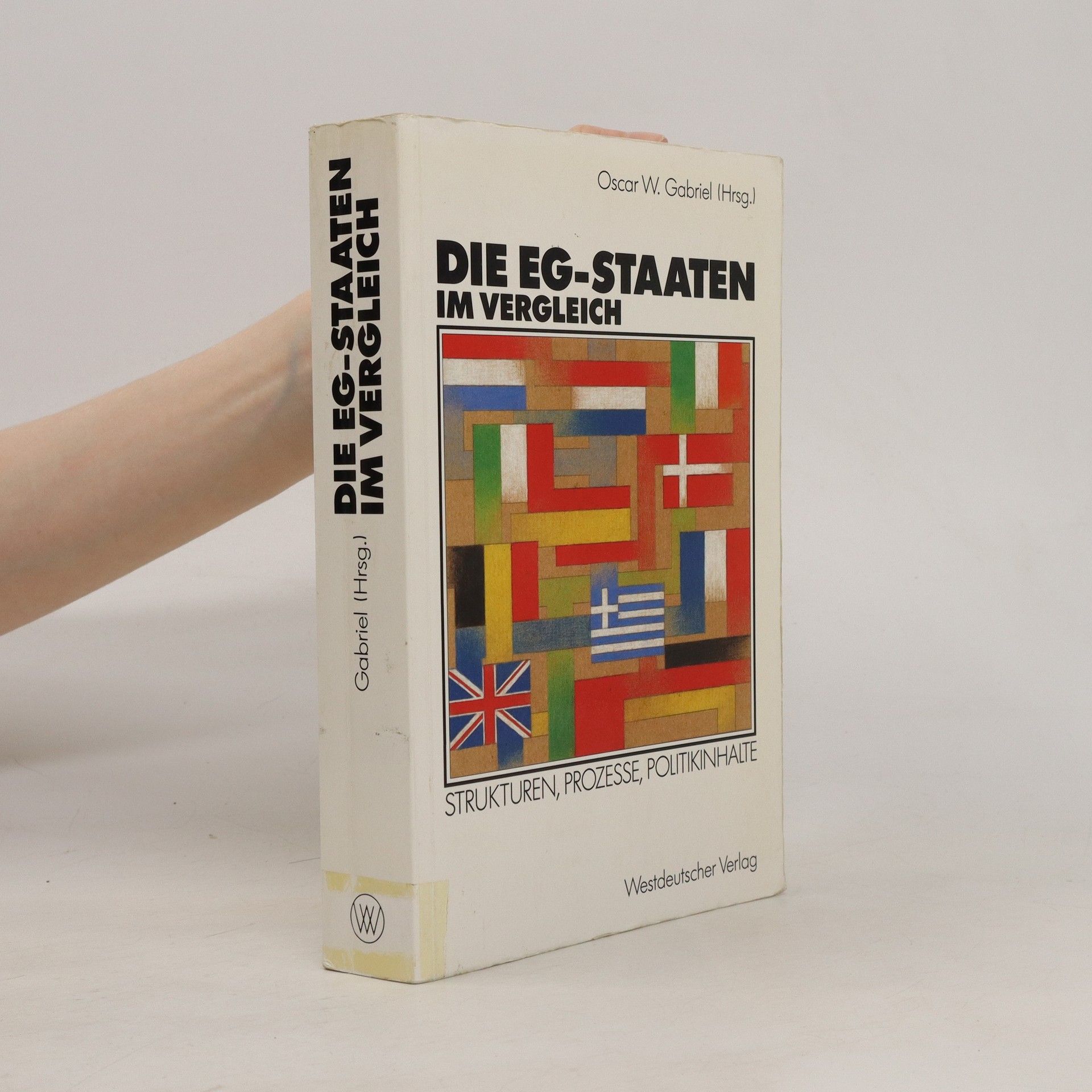Politische Partizipation
Eine Einführung in Theorie und Empirie
Politische Partizipation ist ein wichtiges Element der Demokratie. Sie legitimiert politische Herrschaft und verbindet die Regierenden und Regierten miteinander. Deshalb beschäftigt sich die empirische Partizipationsforschung schon seit langem mit der Frage, wer sich in welcher Form, aus welchen Gründen und mit welchen Folgen politisch engagiert. Das Lehrbuch gibt einen Überblick über Ausmaß, Formen und Bestimmungsfaktoren politischer Partizipation in Deutschland und führt in die theoretischen und methodischen Grundlagen der empirischen Partizipationsforschung ein.