Von Advent bis zum Dreikönigstag, vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart - verschiedenste Aspekte der Geschichte des Weihnachtsfestes werden in diesem Buch auf ihre Entwicklung und ihre geschichtlichen Hintergründe untersucht. Das Hauptquellenmaterial bilden handschriftliche Berichte des Archivs für westfälische Volkskunde, Veröffentlichungen in Heimatbüchern, Zeitschriften und Kalendern, Zeitungsberichte und -annoncen. Folgende Themen werden eingehend behandelt: Adventskranz und Adventskalender, Nikolausbräuche, Armenfürsorge, Weihnachtsbäckerei, Weihnachtsschmuck der Städte und Dörfer, Thomasbrauch, Ausgestaltung des Heiligen Abends und des ersten Weihnachtsfeiertages, Geschenksitten, volkstümliche Glaubensvorstellungen zwischen Weihnachten und Neujahr, die Feier des Neujahresfestes und des Dreikönigstages sowie die Unterschiede von evangelischer und katholischer Ausgestaltung der Feste. Die Darstellung umfasst alle westfälischen Landesteile von Lübecke bis Siegen und von Anholt bis Höxter.
Dietmar Sauermann Bücher
25. Februar 1937 – 9. August 2011

![Weihnachten in Westfalen um 1900 [neunzehnhundert]](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/24121635.jpg)

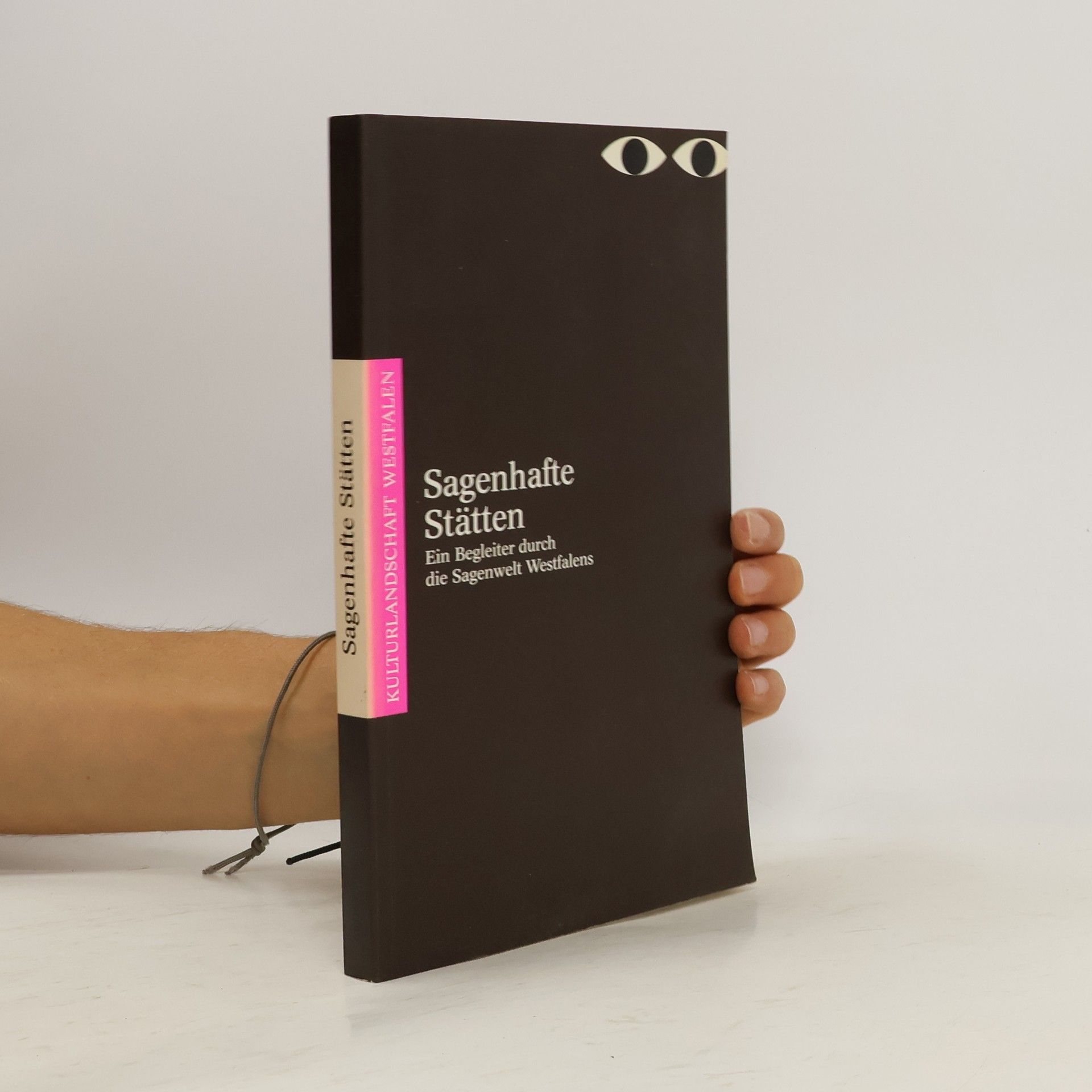
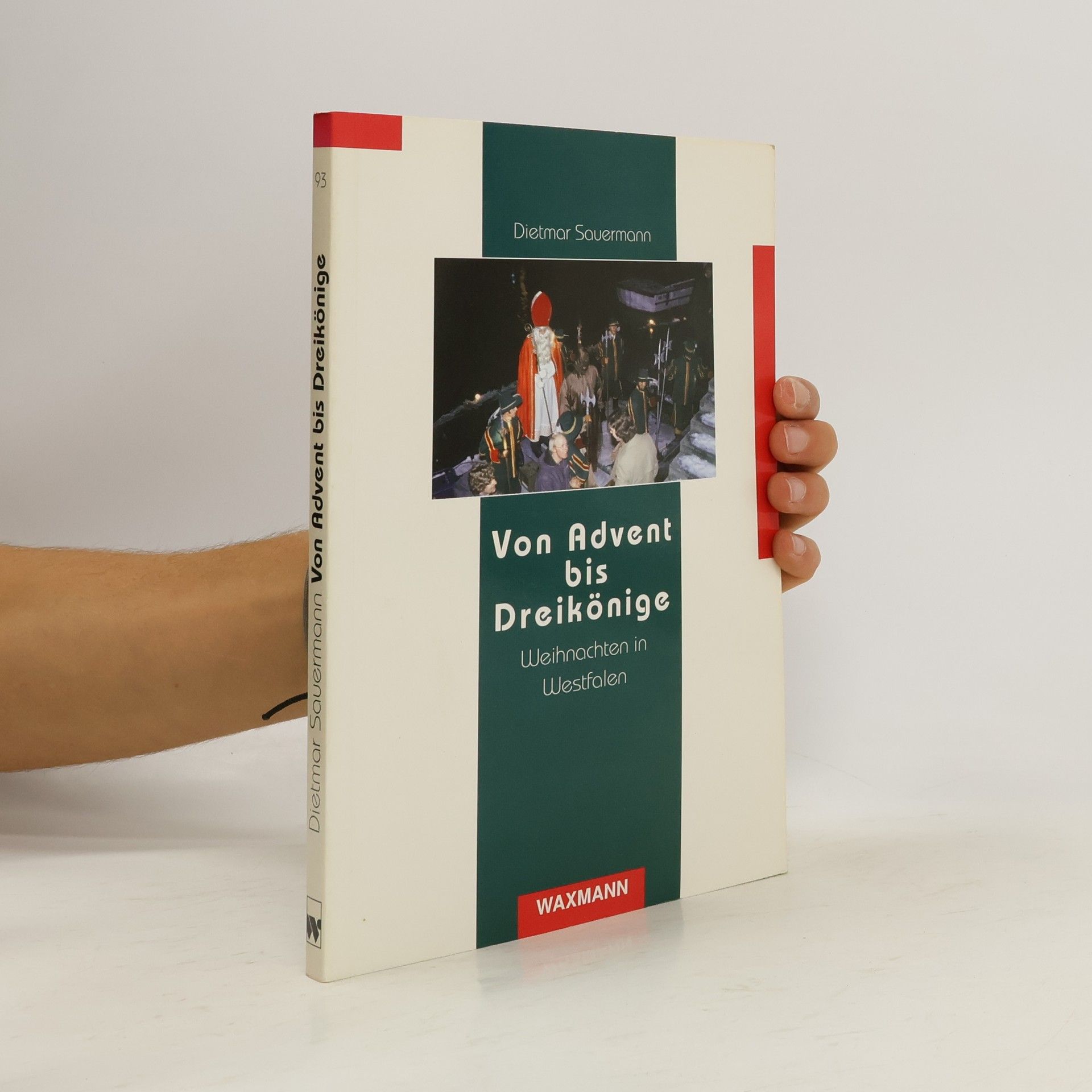
Was erzählt man sich in Westfalen von Gnomen, Hexen, Irrlichtern, Spukgeistern, armen Seelen, Hünen, Raubrittern und Schildbürgern? Dem spürt dieser Reisebegleiter nach. Er führt zu über 400 „Sagenhaften Stätten“. Die mit den Orten verbundenen Geschichten, Legenden und Sagen spiegeln die Kulturlandschaft Westfalen wider und zeigen uns Eigentümlichkeiten westfälischer Geschichte und Landschaft.