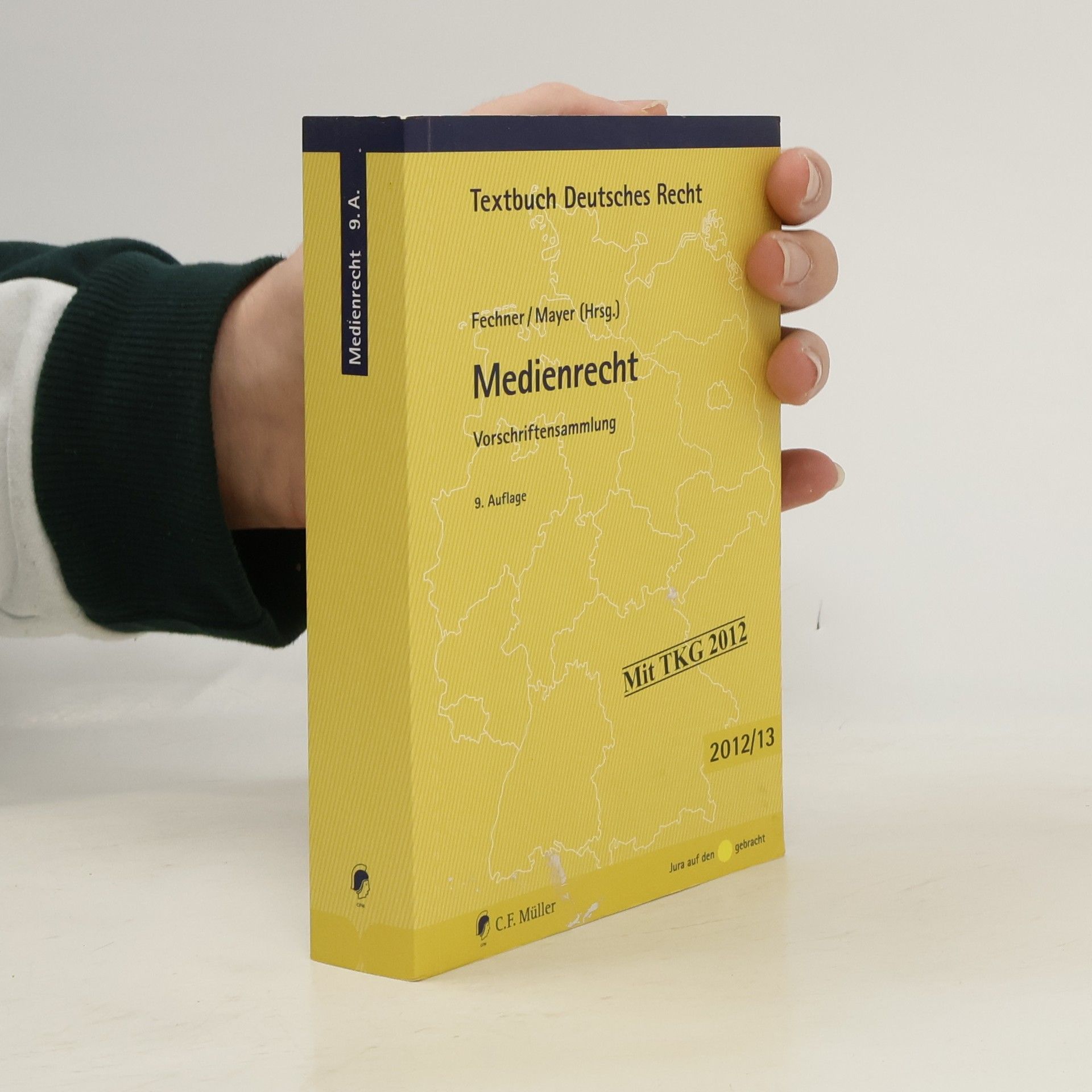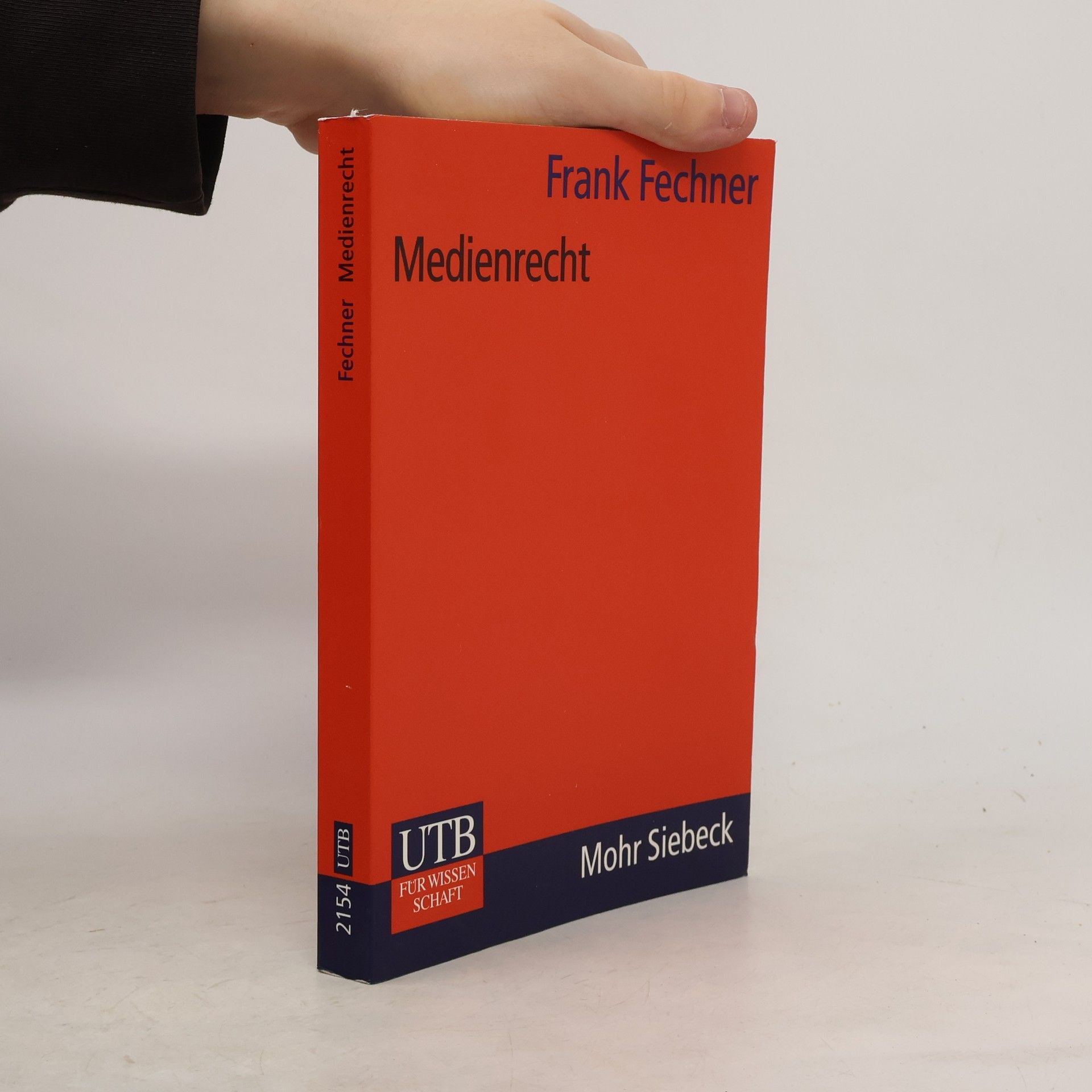Medienrecht
- 453 Seiten
- 16 Lesestunden
„Mit der hohen Anzahl an Auflagen in kurzem Zeitraum wird der Autor den teilweise rasanten Entwicklungen im Medienrecht gerecht und macht das Werk als Gesamtüberblick für praktizierende Juristen, die sich in die Materie einarbeiten wollen und für Studenten, die ihren Schwerpunkt im Medienrecht gewählt haben, praktisch unentbehrlich.“ Bernd Holznagel, Deutsches Verwaltungsblatt 2009, 1233 f.