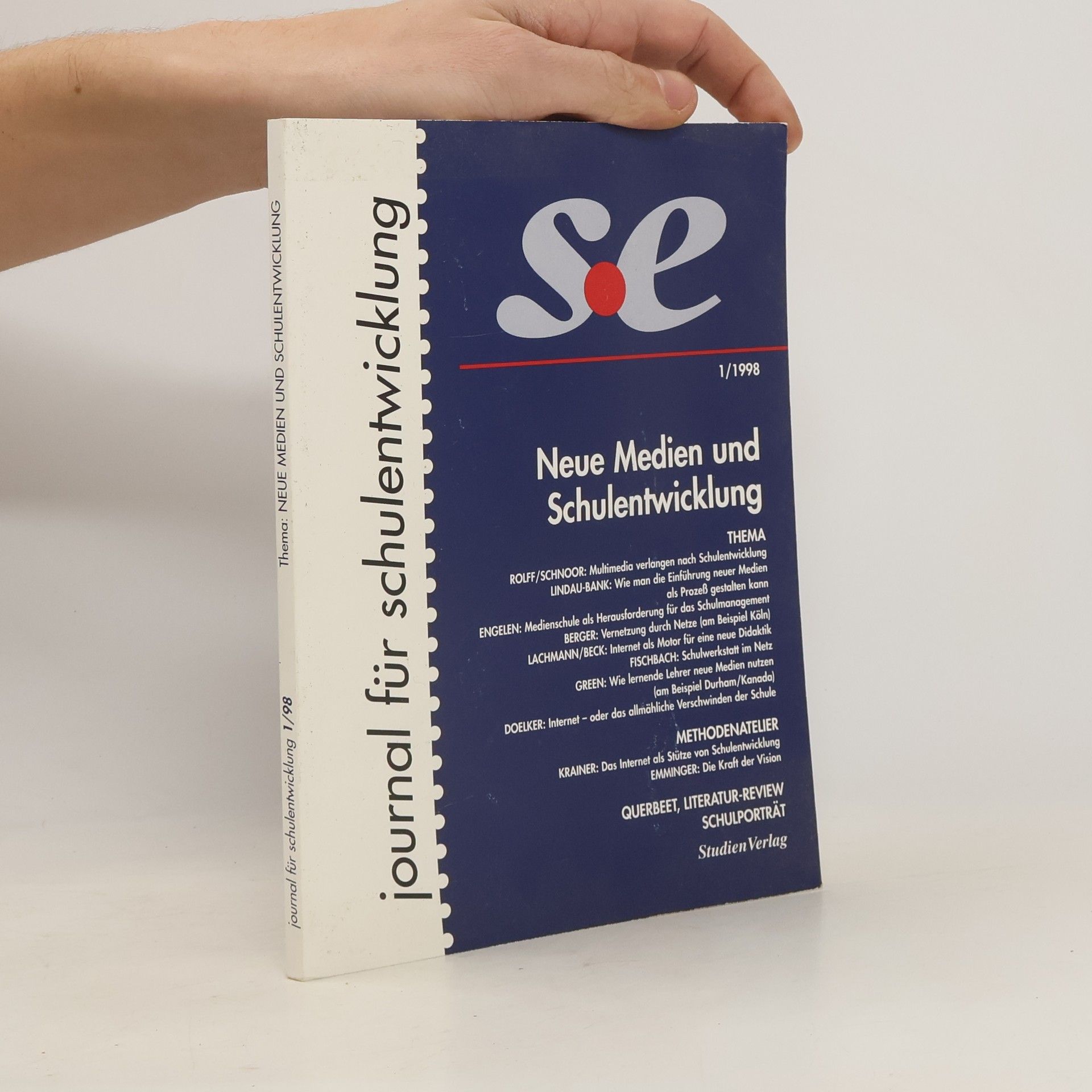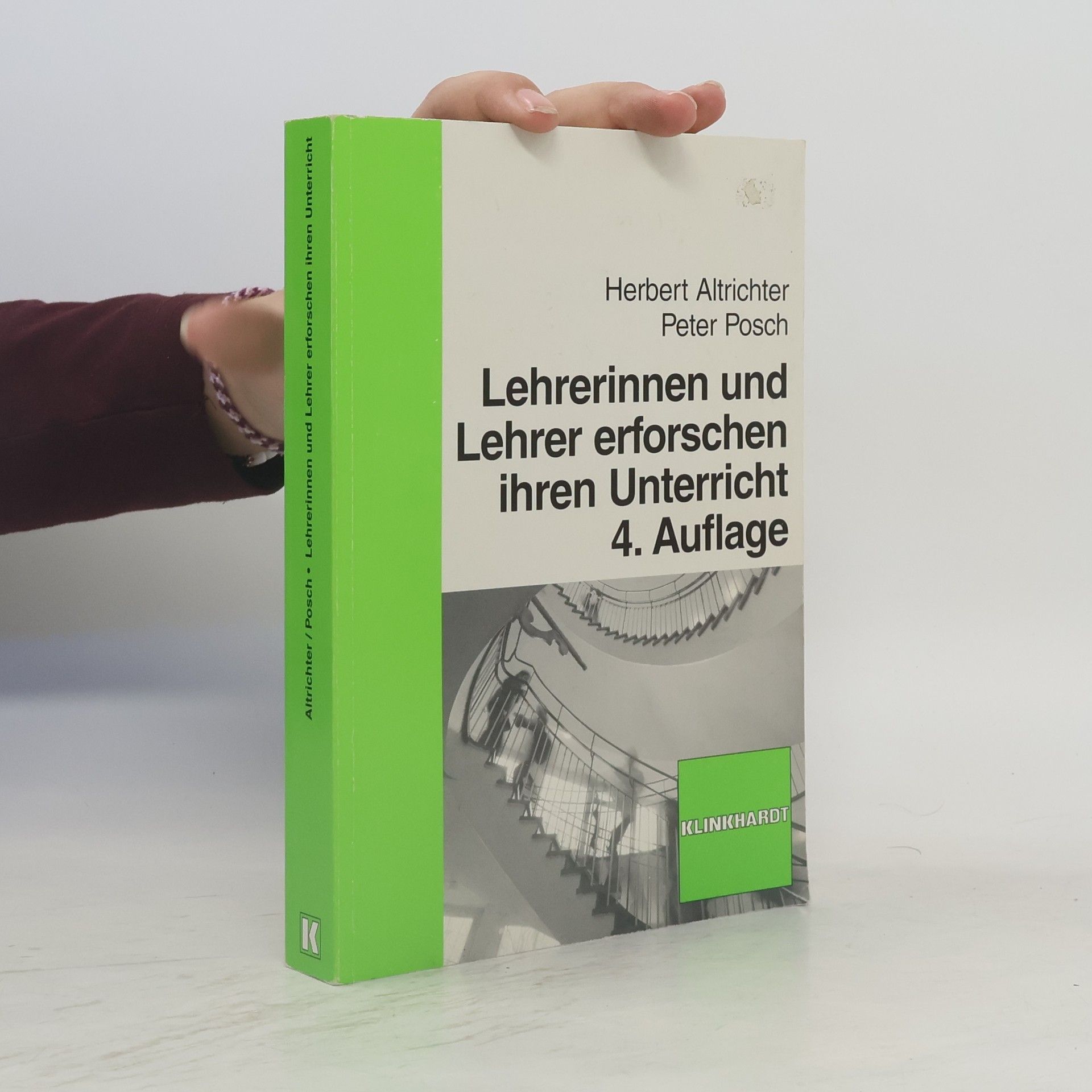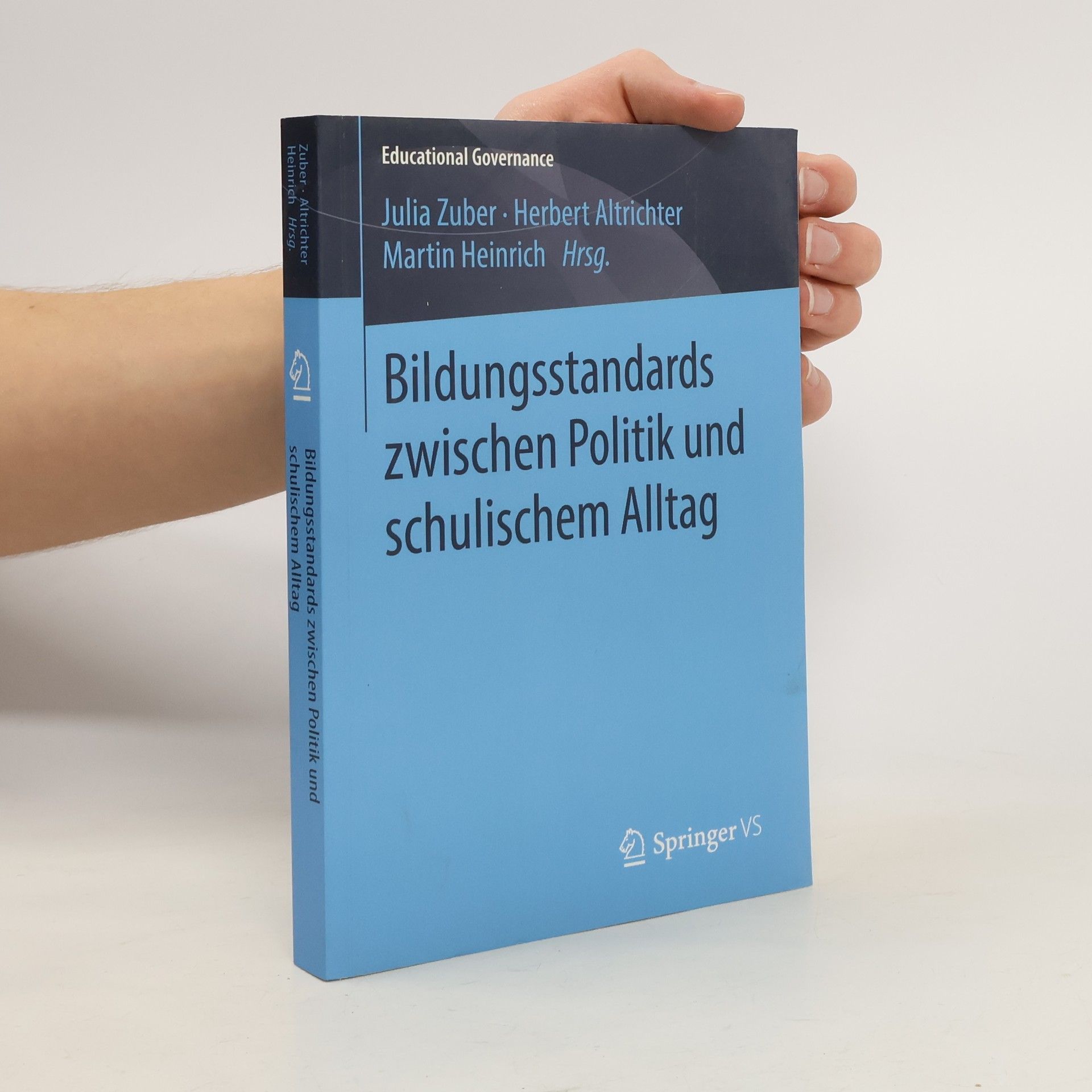10 Jahre Regelschule - die (Neue) Mittelschule
- 373 Seiten
- 14 Lesestunden
Im Schuljahr 2013/2013 wurde die Neue Mittelschule zur Regelschule. Damit einher ging eine der größten Reformen in der Sekundar-I-Stufe, die Österreich in jüngerer Zeit erlebt hat. Der Band versucht, sowohl die Genese und Einführung der Reform zu rekapitulieren als auch anhand empirischer Befunde Auskunft zur UmSetzung der Reform zu geben. Dabei wird neben den Elementen der neuen Lern- und Lehrkultur auch auf die veränderten organisationalen Aspekte eingegangen. Dieser Sammelband bietet eine tiefgreifende Analyse der Reform der Neuen Mittelschule (NMS) in Österreich. Zehn Jahre nach ihrer Einführung als Regelschule werden die Entwicklungen, Herausforderungen und Errungenschaften dieser Reform reflektiert. Der Band leistet einen wichtigen Beitrag, bestehende Forschungslücken zu schließen bzw. auf aktuelle Desiderate hinzuweisen. Von der Entstehungsgeschichte über die konkrete Bearbeitung und Rezeption zentraler Reformbausteine bis hin zu Fragen der Inklusion und Schulqualität werden verschiedene Aspekte beleuchtet. Diese vielschichtige Analyse liefert wichtige Impulse für die weitere Entwicklung des österreichischen Bildungssystems und bietet die Möglichkeit, tiefere Einblicke in eine systemweite Reformausrollung zu erhalten.